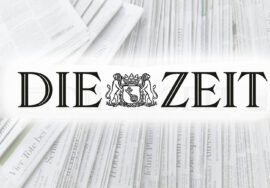FALTER
Klimakrise: Keine fossilen Brennstoffe, keine Rohstoffe – und trotzdem darf die Wirtschaft wachsen. Der führende Klimaforscher Anders Levermann ist überzeugt, dass das geht
Leben wir schon in der Klimakatastrophe? Nein, winkt Anders Levermann ab. Müssen wir uns wegen der Klimakrise vom Wachstum verabschieden? Auch hierzu sagt er entschieden nein. Dabei ist Anders Levermann einer der führenden europäischen Klimaforscher. Der 50-Jährige leitet die Abteilung Komplexitätsforschung am einflussreichen Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Seit 20 Jahren ist er Co-Autor des UN-Weltklimarats, er berät Wirtschaft und Politik.
Falls sich jetzt jemand freut: „Sag ich’s doch! Diese Klimahysteriker übertreiben“, wird er hart enttäuscht. Levermann erklärt nämlich auch: Wenn wir so weitermachen, wird es noch viel, viel schlimmer als heute. Ein Extremwetterereignis wird das nächste jagen: Dürren, Überflutungen, Hurrikans. Die Menschheit werde zwischen alledem nicht mehr zum Aufräumen kommen. Die Extreme könnten „alle Brotkörbe der Welt“ gleichzeitig treffen und die Nahrungsmittelversorgung der Erde in Gefahr bringen. Ab zwei Grad plus, meint der Physiker, gerieten auch die Demokratien ins Wanken. Daher fordert er null Emissionen, und das bald. Kohle, Öl und Gas müssten in der Erde bleiben, dies müsse mit harten Verboten durchgesetzt werden. Aber keine Angst, ruft Levermann zugleich: Die Wirtschaft darf trotzdem weiter wachsen! Möglich werde das durch das mathematische Prinzip der Faltung.
Anders Levermann fordert Umwälzungen, die vielen wohl den Atem stocken lassen. Kleckern ist nicht das Seine, er schlägt den richtig riesigen Bogen. Nicht nur der Klimakrise will er beikommen, sondern auch dem Artensterben. Nach dem Ende aller Emissionen müsse nämlich auch der Abbau von Rohstoffen stoppen – künftig dürften wir nur noch verwenden, was nachwächst oder sich aus schon Vorhandenem recyceln lässt.
Gleich zu Beginn macht er klar, warum die Nullemissionen „leider nicht verhandelbar“ seien. Selbst wenn die Menschheit dramatische vier oder mehr Grad plus akzeptieren würde, müsse sie irgendwann aufhören zu emittieren: Denn solange CO2 in die Atmosphäre kommt, heizt die Erde sich weiter auf. „Man könnte etwas flapsig sagen: Es sind die Dinosaurier und ihr Futter, die wir jetzt wieder ausgraben und verbrennen. Damit treiben wir die Erde in eine Hitze, die seit den Dinosauriern nicht mehr auf dem Planeten geherrscht hat.“ Würden wir alles bisher gefundene Öl, alles Gas und alle Kohle verbrennen, würden wir die Erde um 15 Grad aufheizen.
Wenn er „null Emissionen“ vor Wirtschafts- und Industrievertretern fordert, erzählt Levermann, dann könnten die durchaus etwas damit anfangen. Null bedeutet nämlich nicht: Wir machen irgendwas ein bisschen weniger, sondern: Wir machen alles anders. Und damit könne die Wirtschaft arbeiten, „denn ,anders‘ bedeutet Innovation, bedeutet Fortschritt“.
Bei der Frage, wie das mit dem Wachstum zusammengehen soll, bringt er das Prinzip der Faltung ins Spiel: Die entsteht, wenn man einem System eine Grenze setzt. Es sucht sich dann unterhalb der Grenze neue Wege und wächst stattdessen in die Vielfalt. Wie der Amazonas-Regenwald, der nicht einfach expandieren konnte – stattdessen haben die Tiere und Pflanzen im begrenzten Raum eine unendliche Diversität hervorgebracht. Oder ein Vogelschwarm: „Er darf nicht in den Ozean stürzen und nicht ins luftleere Weltall fliegen, aber zwischen diesen natürlichen Grenzen besteht unendliche Freiheit.“
Genauso werde es der Menschheit gehen, wenn sie an die absolute Grenze der Nullemission stößt. Dann muss sich der Pfad, auf dem sich die Gesellschaft befindet, in den endlichen Raum „zurückfalten“ – und werde hier immer neue Wege finden, das Leben zu verbessern.
Praktisch bedeute das etwa, nicht das Fliegen zu verbieten, sondern nur den CO2-Ausstoß. Die Suche nach Alternativen, ja generell nach den besten Lösungen, könne man getrost Wirtschaft und Gesellschaft überlassen („die beste Suchmaschine der Welt“). Faltung meine das Gegenteil einer geplanten Strategie und auch das Gegenteil von Planwirtschaft.
Dass Nullemissionen in nicht allzu ferner Zukunft möglich sind, davon ist Levermann überzeugt. Schon bald lasse sich die Energieversorgung zur Gänze aus Erneuerbaren speisen.
Man merkt dem Buch an, wie lange und tiefgehend sich der Autor schon mit diesen Themen befasst, dass er sich seit zehn Jahren auch mit deren ökonomischen Aspekten auseinandersetzt und seine Argumente in vielen Debatten gestählt hat.
Einwände nimmt der Autor vorweg. Bei der Energiewende zum Beispiel besteht die Hauptsorge darin, dass die Versorgung zusammenbricht, weil die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer bläst. Der Trick bestehe darin, dass sich große Regionen zu Energiepakten zusammenschließen, etwa die gesamte Europäische Union. So könnten sich Tief- und Hochdrucksysteme ausgleichen.
Viel Diskussionsstoff lauert natürlich in seiner These, all die radikalen Reformen ließen sich bei gleichzeitigem Wachstum umsetzen. Zahlreiche Ökonomen arbeiten sich an diesem Thema ab. Taz-Autorin Ulrike Herrmann plädiert in ihrem brillant argumentierten Buch „Das Ende des Kapitalismus”“ (2022) für eine kontrollierte Schrumpfung der Wirtschaft, der japanische Philosoph Kohei Saito hat kürzlich mit „Systemsturz“ einen Bestseller für die Degrowth-Bewegung gelandet (Rezensionen sowie ein Interview mit Herrmann finden Sie unter www.falter.at/shop). Ihr zentraler Einwand: Unendliches Wachstum in einer Welt mit endlichen Ressourcen sei unmöglich.
Levermann ist da ganz bei ihnen – wenn Wachstum im klassischen Sinn gemeint ist, ohne Grenzen. Er plädiert ja dafür, dass die Menschheit in nicht allzu ferner Zukunft keine weiteren Rohstoffe aus der Natur entnimmt. Industriekreise würden so etwas gern als „unrealistisch“ abtun, aber: „Es gibt keine härtere Realität als die, dass man aus einem endlichen Planeten nicht unendlich lange Materialien entnehmen kann.“
Dass er dennoch am Wachstumsgedanken festhält, argumentiert Levermann damit, dass dieser eine zentrale Antriebskraft sei. Er lasse Menschen in der Früh aufstehen, bringe sie dazu, Ideen zu entwickeln, und sorge dafür, dass notwendige Güter bereitgestellt werden. Dieses Prinzip aufzugeben fände er „nur dann moralisch vertretbar, wenn es auf der festen Überzeugung beruhte, dass man an seine Stelle etwas Vergleichbares setzen kann“. Dieses Andere sehe er nicht. Zudem stehen wir wegen der Klimakrise unter enormem Zeitdruck. Also, meint Levermann: Behalten wir doch das System, verzichten aber künftig auf die Zerstörung der Natur.
Um den Widerspruch mit den endlichen Ressourcen aufzulösen, sieht er mehrere Möglichkeiten. So könnten wir lernen, hauptsächlich mit nachwachsenden Rohstoffen auszukommen. Darüber hinaus müssten wir eben mit dem auskommen, was bereits abgebaut und verwendet wurde. Da nach dem Umbau auf Erneuerbare sogar mehr Energie zur Verfügung stehen werde als heute – „denn die Menge der Sonnenenergie ist unendlich“ –, werde phasenweise sogar zu viel Strom bereitstehen. Und den könne man zum Recyceln nutzen. Außerdem sieht der Forscher noch sehr viel Bedarf an (immateriellen) Dienstleistungen: an Bildung und Kinderbetreuung, Gesundheit und Pflege.
Dem Kapitalismus liest Levermann aber auch die Leviten. Er verstehe das Unbehagen, das viele mit dessen heutigem Erscheinungsbild haben: damit, dass Leistung und Einkommen oft nichts mehr miteinander zu tun hätten, dass Vermögen bis zur Absurdität auseinanderdriften. Daher schlägt er neben den beiden ökologischen „Faltungsgrenzen“ – null Emissionen, null Rohstoffabbau – drei weitere vor: die Begrenzung von Firmengrößen, des Erbes, das eine einzelne Person bekommen darf, und von Einkommensunterschieden. Falls nun jemand meint, da wolle einer den Kommunismus über die Öko-Hintertür einführen, braucht man sich nur die sehr hohen Grenzen ansehen, die Levermann vorschlägt: So sollten etwa maximal zwei Millionen Euro an eine einzelne Person vererbt werden dürfen. Es gehe darum zu verhindern, dass Firmen so groß werden, dass sie den Wettbewerb aushebeln und dass mächtige Megakonzerne das Primat der Politik über die Wirtschaft in Frage stellen. Der nicht begrenzte Kapitalismus schaffe nämlich gerade seine Tugenden ab. Das gehöre gestoppt.
Zack – das ist wirklich ein umfassendes Gedankengebäude. Levermann beleuchtet seine Vorschläge von allen möglichen Seiten: Er hat ein Kapitel „Argumente für Kapitalisten“, eines „für Kommunisten“ und eines „für Pragmatiker“ geschrieben. Es gibt sehr viel zu lernen in diesem Buch: von Grundlegendem über die Klimakrise (was uns nicht droht, was uns droht) bis zu den großen Debatten, wie dieser beizukommen wäre. Bei alledem ist das Buch glänzend erzählt, Hamlet tritt genauso auf wie Harry Potter, und jedes Kapitel beginnt mit einem Zitat aus einem Song von Tom Waits.
Freilich werfen die kühnen Thesen einen ganzen Strauß an Fragen auf. Kann das mit den Nullemissionen bei gleichzeitigem Wachstum wirklich klappen? Was ist mit all dem Kupfer und den Seltenen Erden, die wir (derzeit noch) für die Energiewende brauchen? Wird Levermann mit seiner Hoffnung Recht behalten, er könne nicht glauben, dass es keine andere Möglichkeit gibt, eine Windturbine zu bauen?
Auch mahnt der Autor, die staatlichen Verbote müssten ganz hoch ansetzen. Kein Kleinklein, keine unnötige Bevormundung. Den Rest solle man in demokratischen Prozessen der Gesellschaft überlassen. Allerdings ist doch auch der europäische Emissionshandel, den Levermann als Positivbeispiel sieht, ziemlich detailliert.
All das ist aber nicht schlimm. Levermann schreibt dezidiert, er habe keine Rezepte; das widerspräche ja seinem Konzept, wonach die vielen Menschen da draußen die Lösungen schon finden werden.
Es ist ein bahnbrechendes Klimabuch. Wohltuend, weil optimistisch und versöhnlich, gleichzeitig im besten Sinne radikal. Weil die physikalischen Fakten eben sind, wie sie sind. Oder wie Tom Waits formuliert: „You can drive out nature with a pitchfork, but it always comes roaring back again.rtikel »